Ich lese gerade das ganz wunderbare Buch „Wie man Mensch wird – auf den Spuren der Humanisten“ von Sarah Bakewell. Und da stolperte ich über diese Stelle:
Als die Druckerpresse Europa eroberte, war die Begeisterung keineswegs einhellig. Der Herzog von Urbino ließ wissen, er wolle mit gedruckten Büchern nichts zu tun haben. Das war kein Spleen, sondern ein kulturpolitisches Statement. Bücher sollten seiner Meinung exklusiv bleiben, ein Privileg der Gelehrten, nicht des Volkes. Wissen war Macht und Macht will immer schon ihre Kanäle kontrollieren. Der Buchdruck aber demokratisierte die Schrift und drohte, jene Ordnung zu erschüttern, die auf Seltenheit und Standesbewusstsein gründete.
Johannes Trithemius, Benediktinerabt und Humanist, argumentierte ähnlich. In seinem Traktat De laude scriptorum lobte er die Kunst der Handschrift und erklärte das Kopieren heiliger Texte zur geistlichen Übung. Er erklärte, das Kopieren von Texten sei eine geistliche Übung. Die Hände der Mönche seien nicht nur Schreiber, sondern Betende. Wenn nun Buchdrucker das setzen, was vorher Mönche schrieben, dann ist das nicht nur eine technische Umstellung. Es ist ein Angriff auf Identität. Und besonders beunruhigend: Die Mönche würden überflüssig werden, ihre Berufung entwertet, ihr Status infrage gestellt. Die Lettern des Buchdruckers produzierten in Stunden, wofür Mönche Tage brauchten. Hinter der religiösen Kritik stand aber auch eine existentielle: die Angst vor der Entwertung des eigenen Könnens. Die Kopisten sahen ihre Berufung schwinden, eine frühe Form von „Jobverlust durch Automatisierung“, lange bevor es das Wort gab.

Auch ästhetisch galt der Druck vielen als Zumutung. Pergament war haltbar, Papier schien billig. Handschriften waren Unikate, reich verziert, liebevoll geformt. Gedruckte Bücher dagegen wirkten nüchtern, maschinell, uniform. Dass gerade diese Gleichförmigkeit ihre Stärke war, erkannten nur wenige. Edward Gibbon sah es später klarer: Der Buchdruck sei „eine Kunst, die der Zerstörung durch die Zeit und die Barbarei spottet“.
Ironischerweise ließ Trithemius übrigens sein eigenes Loblied auf die Schreiber schließlich drucken, ein frühes Beispiel dafür, dass auch die größten Skeptiker die neuen Mittel irgendwann nutzen.
Die Geschichte des Buchdrucks zeigt: Jede Innovation provoziert zunächst die Verteidiger des Alten. Und doch: Was gestern als Bedrohung galt, wird morgen zum Fundament. Kaum eine andere Technik hat den menschlichen Geist so befreit und gleichzeitig so viele Ängste ausgelöst.
Schreiben macht vergesslich? Die Angst vor dem Verlust des Alten
Diese Muster kultureller Skepsis sind nicht neu. Schon Sokrates warnte im Dialog Phaidros, die Schrift werde das Gedächtnis schwächen. Wer auf Geschriebenes vertraue, müsse sich nichts mehr merken, also werde der Geist träge. Die Angst lautet hier: Technik nimmt uns Fähigkeiten ab und damit ein Stück Menschlichkeit. Die Sorge vor einer „geistigen Verweichlichung“ begleitet Mediengeschichte seit der Antike.
Im Rückblick wirkt diese Furcht fast rührend. Kaum jemand würde heute sagen, Schrift habe uns dümmer gemacht. Im Gegenteil, sie hat kulturelles Gedächtnis überhaupt erst ermöglicht. Aber kulturelle Innovation bedeutet immer auch: Etwas wandelt sich. In jedem Fortschritt steckt ein Schatten. Die Frage ist nur, ob wir auf den Schatten starren oder die Möglichkeiten nutzen.
Interessant ist, dass die Kritik nie verschwindet, sondern immer neu formuliert wird. Heute heißen die Warnungen nicht mehr Gedächtnisverlust durch Schrift, sondern durch Google und KI. Man müsse nichts mehr wissen, weil man alles jederzeit nachschlagen kann. Es geistern auch schon wieder „Studien“ durch das Netz, die anschaulich zeigen, wie die Gehirne der Menschen verkümmern, sobald sie KI nutzen.Die Argumentstruktur ist identisch. Die Namen ändern sich, die Angst bleibt.

Lesefieber, Lesewut, Lesesucht
Als der Roman massenhaft Leserinnen und Leser gewann, reagierte die Kultur mit Warnschildern. Ärzte und Pädagogen diagnostizierten im 18. und 19. Jahrhundert eine „Lesesucht“, zu viel Fiktion mache krank, schwäche den Körper, zersetze die Sitten. Der Melanchologe Robert Burton klagte schon 1621 über eine „Überfülle an Büchern“, die die Augen schmerze und den Geist ermüde. Hinter der Sorge stand wieder dasselbe Motiv: Was jeder haben kann, entwertet das, was wenige exklusiv beherrschen.
Goethes Werther schärfte die Debatte. Der Roman wurde verdächtigt, suizidales Verhalten zu befeuern. Der später so genannte „Werther-Effekt“ ist bis heute umstritten und wurde oft überzeichnet. Entscheidend ist das kulturelle Muster: Ein neues Erzählformat, das Gefühle ernst nimmt und Autoritäten infrage stellt, wirkt bedrohlich, bevor es normal wird. Dass wir heute Romane lesen, um uns zu bilden, zu trösten oder zu unterhalten, zeigt, wie schnell sich Misstrauen in Alltag verwandelt.
Gleichzeitig stimmt ein Teil der frühen Kritik: Medien verändern Zeitbudgets, Aufmerksamkeiten und unsere Routinen. Lesesucht als Krankheitsbild war überzogen, aber die Beobachtung, dass wir uns in Geschichten verlieren können, blieb richtig. Medienkritik ist nicht falsch, wenn sie Maß und Mitte sucht. Sie wird dann problematisch, wenn sie das Neue pauschal dämonisiert.
Das Telefon: Nähe aus der Ferne und der Schreck der Institutionen
Auch das Telefon erschien vielen Zeitgenossen zunächst als unhöflich: zu direkt und zu entgrenzend. Eine Stimme dringt ins Haus, ohne anzuklopfen – shocking! Das Gespräch verliert seine Bühne von Briefpapier, Salon und Besuchsstunde. Die Intimität der Stimme ohne Blickkontakt irritierte und schürte die Angst, das soziale Taktgefühl werde leiden. Dass sich durch das Telefon gleichzeitig eine neue Form von Nähe eröffnete, fiel dem ersten Urteil noch nicht auf.

Institutionen und Geschäftsmodelle sahen zusätzlich ihre Ordnung in Gefahr. Telegramme, Boten, Postrouten, alle eingefahrenen Infrastrukturen wurden plötzlich umgangen. Berühmt ist ein oft zitiertes, historisch zweifelhaftes Western-Union-Memo, der Inhalt lautet sinngemäß etwa so:
„Das Telefon hat zu viele Mängel, um ernsthaft als Kommunikationsmittel in Betracht gezogen zu werden. Das Gerät hat für uns keinen Wert.“
Oft wird behauptet, die Western Union habe das in einem internen Memo geschrieben, als Alexander Graham Bell ihnen das Telefon anbot und sie ablehnten. Ob exakt so gesagt oder nicht: Der Geist des Einwands ist belegt. Nicht die Technik selbst, sondern der Kontrollverlust über bewährte Wege war – wie immer – das Problem.
Heute telefonieren wir weniger als früher und kommunizieren zugleich mehr. Die Technik hat das Gespräch nicht zerstört, sondern verteilt: in Anruf, Nachricht, Sprachnotiz, Videocall. Was zunächst als Verlust erschien, wurde zur Vielfalt. Der entscheidende Schritt war nicht technischer, sondern kultureller Natur, denn die Regeln, Etikette und auch unsere Erwartungen mussten neu ausgehandelt werden.
Comics, Fernsehen und der ewige Kulturpessimismus
Mit den Comics der 1940er und 1950er Jahre schlug die Skepsis wieder hoch. Als Comics populär wurden, sahen Kritiker darin den Untergang des Abendlandes in bunten Panels. Der Comickritiker Fredric Wertham schrieb 1954 in Seduction of the Innocent, Comics seien „simple, mechanical and violent“ – eine „Verführung der Unschuldigen“. In den USA führte der Aufruhr zum „Comics Code“, einer freiwilligen Zensur der Branche. Dass Comics zugleich Kunstform, Satire und auch Gesellschaftskommentar waren, interessierte niemanden. Massenkultur war verdächtig, weil sie die Unterscheidung zwischen Hoch und Niedrig verwischte.
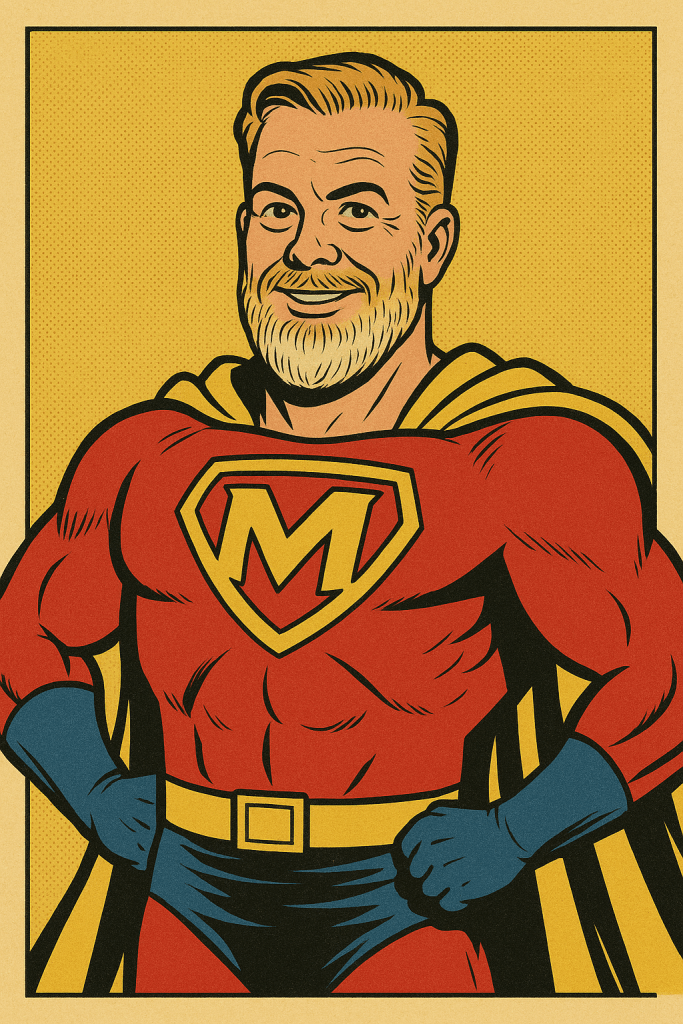
Als das Fernsehen in die Wohnzimmer zog, folgte die nächste Welle. Newton N. Minow, Vorsitzender der Federal Communications Commission (FCC), nannte das US-Fernsehen 1961 in einer berühmten Rede eine „vast wasteland“, eine „weite Ödnis“. Er hatte recht und unrecht zugleich. Ja, es gab viel seichte Unterhaltung. Aber es gab auch Nachrichten, Dokumentationen, Bildung und eine neue, gemeinsame Referenzkultur. Viele fürchteten, es würde das Gespräch ersetzen und die Familie in Schweigen tauchen. Heute wissen wir: Es schuf neue gemeinsame Momente – von Mondlandung bis zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das Problem war nie das Gerät, sondern die Inhalte, die Ökonomie dahinter und unser Umgang damit.
Beide Debatten zeigen das gleiche Muster: Erst die moralische Panik, dann die Differenzierung. Comics sind heute Teil literarischer Kanons, das Fernsehen hat Qualitätsmaßstäbe gesetzt, die nun Streaming weiterführt. Kulturpessimismus ist ein nützliches Frühwarnsystem gegen billige Effekte, aber ein äußerst schlechter Ratgeber, wenn er pauschal urteilt.
Computer, Internet und das smarte Zuhause
Als Personal Computer in den 1970er und 1980er Jahren auftauchten, galt der Nutzen vielen als begrenzt. Ein häufig zitiertes, kontextloses Ken-Olsen-Bonmot („Niemand braucht einen Computer zu Hause“) verdichtet diese Skepsis, auch wenn Olsen über Industrie-Terminals sprach. Die Vorstellung, ein Rechner könne Privatleben und Arbeit verändern, war schwer zu fassen. Noch 1995 spottete der Astronom Clifford Stoll in Newsweek, das Internet werde keinen Handel, keine Bildung, keine sozialen Kontakte revolutionieren. Menschen unterschätzen eben oftmals nicht die Technik, sondern die Gewohnheiten. Was man sich nicht vorstellen kann, hält man für überflüssig. Wer heute eine Bahnkarte oder einen Kühlschrank bestellt, weiß, wie falsch gute Köpfe liegen können.
Die Lehre ist milde: Nicht Dummheit führt zu Fehleinschätzungen, sondern Erfahrungsökonomie. Wir überschätzen das Bekannte und unterschätzen das, was noch keine Alltagspraktiken gefunden hat. Sobald diese Praktiken entstehen, wie grafische Oberflächen, Suchmaschinen, Online-Bezahlung, mobile Netze, dann kippt die Wahrnehmung. Aus dem „Warum?“ wird ein „Womit sonst?“.
Gleichzeitig wurden neue Risiken sichtbar: Überwachung, Plattformmacht, Suchtmuster. Das bestätigt nicht die Frühkritik, sondern fordert reife Antworten. Technik ist nie nur Lösung. Sie ist immer auch Anlass, Regeln zu verabreden. Und genau hier entscheidet sich, ob sie uns dient.
Smartphone und Gesprächskultur
Mit dem Smartphone wurde Kommunikation permanent und allgegenwärtig. Die Soziologin Sherry Turkle beschreibt, wie ständige Erreichbarkeit das offene, ungetaktete Gespräch verdrängen kann. Sie nannte es „Alone Together“ – allein miteinander. Und wieder wurde gewarnt: vor Isolation, vor Sucht, und zuviel Zerstreuung. Und wieder gilt: Die Sorge ist berechtigt, aber nicht endgültig. Wir müssen lernen, mit der Technik zu leben, nicht gegen sie. Diese Kritik daran ist grundsätzlich wertvoll, wenn sie nicht apokalyptisch ist, sondern praktisch: Welche Gespräche verlieren wir, wenn wir immer etwas anderes in der Hand haben? Welche gewinnen wir, wenn wir Grenzen setzen?
Die Antwort liegt selten im Entweder-oder. Smartphones verbinden Familien über Kontinente und zerstreuen sie am Esstisch. Sie schaffen Sicherheit auf dem Heimweg und Unruhe im Meeting. Die Technik ist die gleiche, der Kontext macht den Unterschied. Skepsis ist hier kein Widerstand, sondern ein gutes Betriebssystem für Aufmerksamkeit.
Wer Führung verantwortet, kann daraus eine einfache Regel ableiten: Technik wird erwachsen, wenn wir sie ritualisieren. Ein klarer Beginn, ein klares Ende, ein Raum ohne Geräte; das sind keine nostalgischen Gesten, sondern Kulturtechniken, die moderne Teams leistungsfähiger machen.
Künstliche Intelligenz: Der neueste Kandidat
Der KI-Kritiker Joseph Weizenbaum warnte ja schon in den 1970ern, es gebe Entscheidungen, die wir „nicht an Computer delegieren sollten“. Er sah, wie leicht Menschen Maschinen Bedeutung zuschreiben – und wie schnell Verantwortung erodiert, wenn Bequemlichkeit lockt. Jahrzehnte später warnt der Deep-Learning-Vater Geoffrey Hinton vor den Risiken großer KI-Modelle, und zugleich erkennen Millionen ihre Nützlichkeit.
Wieder stehen wir zwischen Faszination und Furcht, zwischen Fortschritt und Überforderung. Und wieder wird sich die Geschichte ähnlich entwickeln wie zuvor: Wir erleben täglich, wie KI Kreativität verstärkt und Routinen automatisiert. Das Muster wiederholt sich: Erst die laute Furcht, dann die nüchterne Aushandlung von Nutzen, Grenzen und Governance. Denn der Mensch lernt nicht Technik, er lernt Umgang.
Der entscheidende Unterschied zu früher: KI ist kein einzelnes Medium, sondern eine Querschnittstechnologie. Sie durchdringt Bilder, Texte, Code, Logistik. Umso wichtiger ist eine Haltung, die weder euphorisch noch defensiv ist.
Wer heute mit KI arbeitet, wiederholt die Gutenberg-Erfahrung im Zeitraffer. Die Kultur murrt, die Praxis lernt, die Regeln ziehen nach. Das ist anstrengend und normal.
Was bleibt: Aus Skepsis Haltung machen
Der Buchdruck, das Telefon, der Computer, die KI, sie alle teilen eine Grammatik: Zuerst wird abgewiesen, was Identitäten, Routinen und Geschäftsmodelle irritiert. Dann wird verhandelt, wer was verliert und was gewinnt. Am Ende wird integriert, was trägt, und reguliert, was schadet. Die Kopisten verloren ihr Monopol, doch das Wissen überlebte und die Welt gewann Bibliotheken. Die Schrift machte vergesslich, aber die Kultur erinnerungsfähig. Das Telefon zerstörte Distanz und schuf Nähe. Das Fernsehen dämpfte Gespräche und eröffnete Horizonte. Comics erschütterten den Bildungskanon, aber erweiterten die Kultur. Computer, Internet und Smartphones machten vieles schneller, aber zwangen uns, neu über Aufmerksamkeit und Macht zu sprechen.
Jede Innovation ist eine kleine Anthropologie des Menschen und seiner Angst, seiner Anpassungsfähigkeit, seiner Lust am Neuen. KI wiederholt diese Erzählung, nur wesentlich schneller.



Hinterlasse einen Kommentar